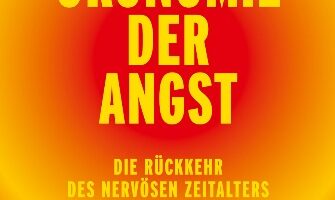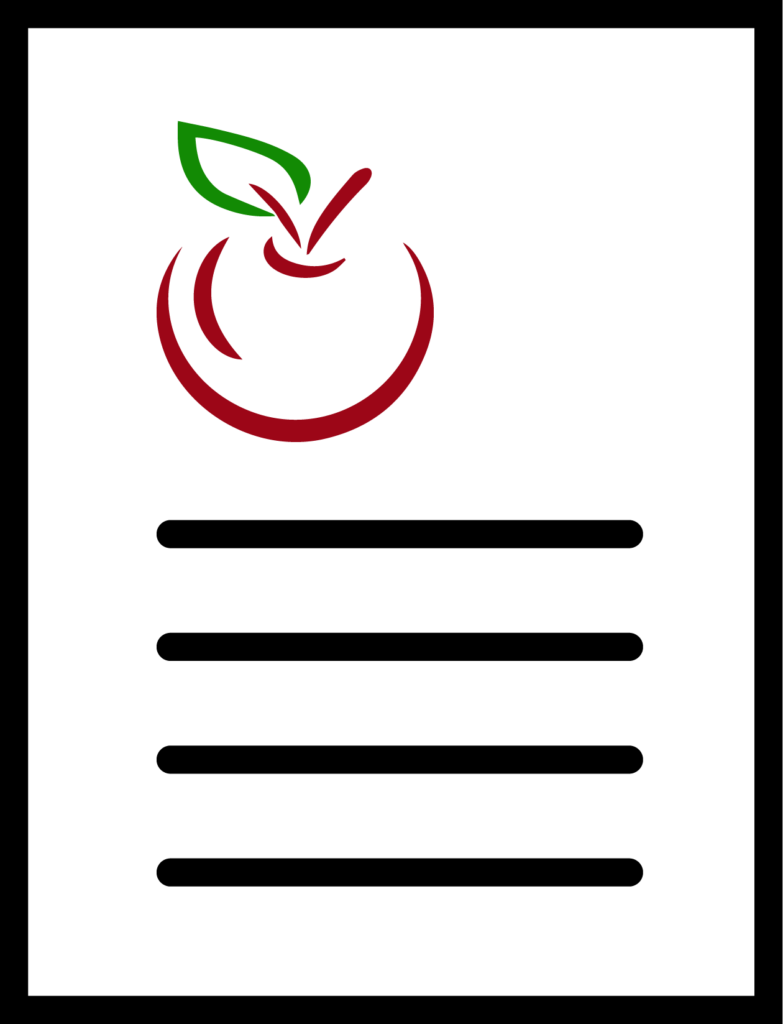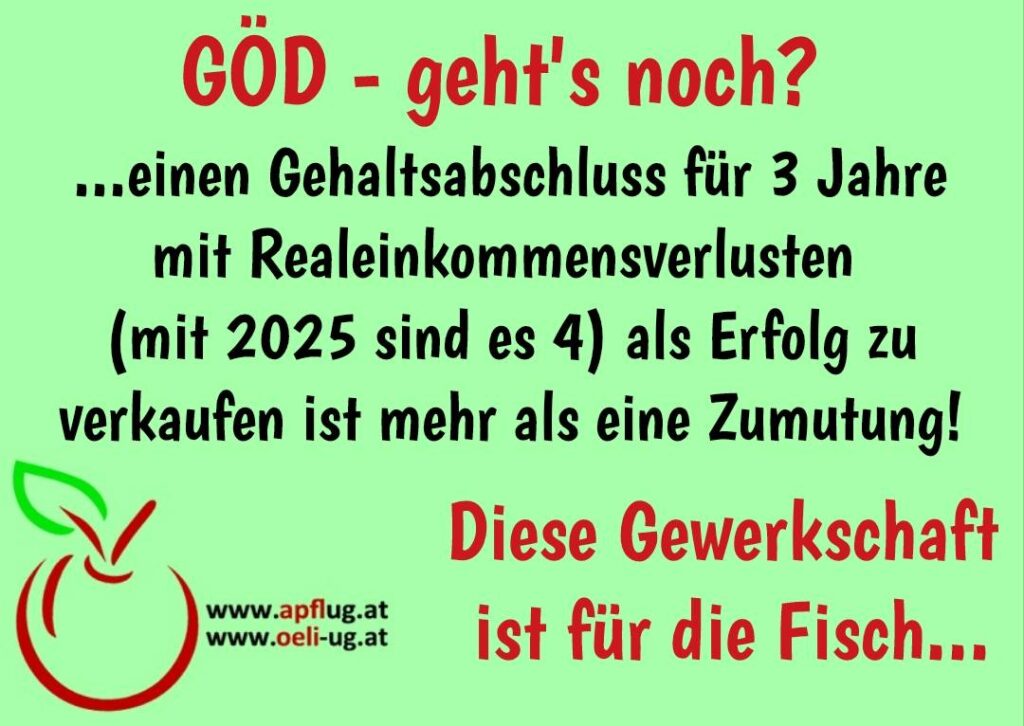- – Eine spekulative Archäologie
Weil in der westlichen Denkwelt alles einen Namen braucht, um begreifbar, erkannt und bearbeitbar zu werden, wird die Zeit, in der wir leben, als Anthropozän benannt. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass Menschen mit ihren Techniken und Verhalten die Erde derart verändern, dass ein lebensbedrohlicher Klimawandel die Folge ist. Architektur ist ein Aspekt unter vielen, die enorme Ressourcen verbrauchen, CO2 Emissionen erzeugen und natürliche Existenzgrundlagen vernichten.
Abb.
https://www.suhrkamp.de/buch/friedrich-von-borries-architektur-im-anthropozaen-t-9783518432020
Der Autor des vorliegenden Buches Friedrich von Borries, Jahrgang 1974, ist Professor an der Hochschule für bildende Künste Hamburg und als Wissenschaftler und Gestalter in den Disziplinen Architektur, Design und Kunst engagiert aktiv.
Seine Kapitelüberschriften lauten: Zerstörung, Überleben, Flucht, Schuld und Hoffnung. Die 64 Seiten im Anhang umfassen Fußnoten, Literaturverzeichnis und Namens-, leider aber kein Stichwortregister.
Er versammelt umfangreich Zahlen und detailreiche Fakten (z. B. dass es seit 2021 mehr menschengemachte Masse als lebendige Biomasse gibt, wovon mehr als die Hälfte Bauwerke ausmachen), setzt diese in Beziehung und wirft auch differenzierte Blicke in die Zukunft. In dieser zählen nicht mehr patriarchale Werte (das Wort Größenwahn füge ich hinzu, wenn ich an den Burj Khalifa denke) und kapitalistisches Handeln, womit er eine spekulative Archäologie entwickelt.
Friedrich von Borries nimmt die Perspektive zukünftiger Archäolog:innen ein und zeichnet damit auch ein Psychogramm gegenwärtiger Industriegesellschaften. Diese Zukunft blickt zurück auf unsere Gegenwart und analysiert die Missstände aller Lebensbereiche aller Lebewesen. Mittels der Kunstfigur Aia stellt der Autor Distanz her. Sie lässt er relevante Fragen nach der Rolle von Beton, Naturzähmung, Eigenheimträumen und anderem stellen. So wird eine spekulative Archäologie entwickelt, auch wenn offen ist, wie rasch und in welchem Ausmaß die Ursachenerforschung Konsequenzen trägt. Das Paradox wird offenkundig, dass Architektur Wohnen und Arbeiten von Menschen verbessern und verschönern wollte und gleichzeitig damit die Weltlage verschlechterte.
In seiner Utopie zukünftige Architektur steht nicht mehr der Mensch mit seinen alleinigen Bedürfnissen im Zentrum, wie dieser auch nicht am Beginn von Architektur stand. Damit positioniert sich der Autor in meinen Augen am labyrinthischen Ausgangspunkt menschlicher Kultur, denn am Beginn wurde ein Miteinander gelebt.
Mit dem weltweiten politischen Aufschwung rechten und nationalen Denkens kommt der Unterscheidung zwischen Wunsch und Wirklichkeit von adäquater Architektur wieder eine größere Rolle zu.
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte kann helfen, meint Friedrich von Borries, Probleme besser zu erkennen, die Lösungen liegen aber nicht auf der Hand. Weil es keine Vorbilder aus der Vergangenheit gibt, müssen Alternativen entdeckt werden, indem neue unbekannte Wege beschritten werden. Er schließt seinen Text mit dem philosophischen und für mich labyrinthischen Gedanken „Es heißt also, sich auf die große Leere einzulassen, darauf zu vertrauen, dass wir das Bestehende öffnen, aufweiten, sprengen können, um zu dem `geheimnisvollen leeren Zentrum` eine Verbindung herzustellen. Vielleicht gelingt dann, irgendwann, ganz bald, ein gemeinsames Anderswerden.“
Für alle, die sich vertiefend in das Thema Architektur mit seinen Bereichen Energiewirtschaft, Industrie, Mobilität, Wohnen, Landwirtschaft, Handel, Müll, Flüchtlingslager, Inseln, Weltraum, einlassen möchten und bereit sind, sich mit Entfremdung, Herrschaft, Täuschung, Vermeidung, Anpassung, Reparatur, Neustart wie auch Ehrlichkeit, Offenheit und Verbundenheit auseinanderzusetzen, ist dieses empfehlenswerte Buch sehr geeignet.
März 2025
Rezension
Ilse M. Seifried,
https://www.i-m-seifried.at
464 Seiten
Suhrkamp 2024
ISBN 978-3-518-43202-0
€ 32,90